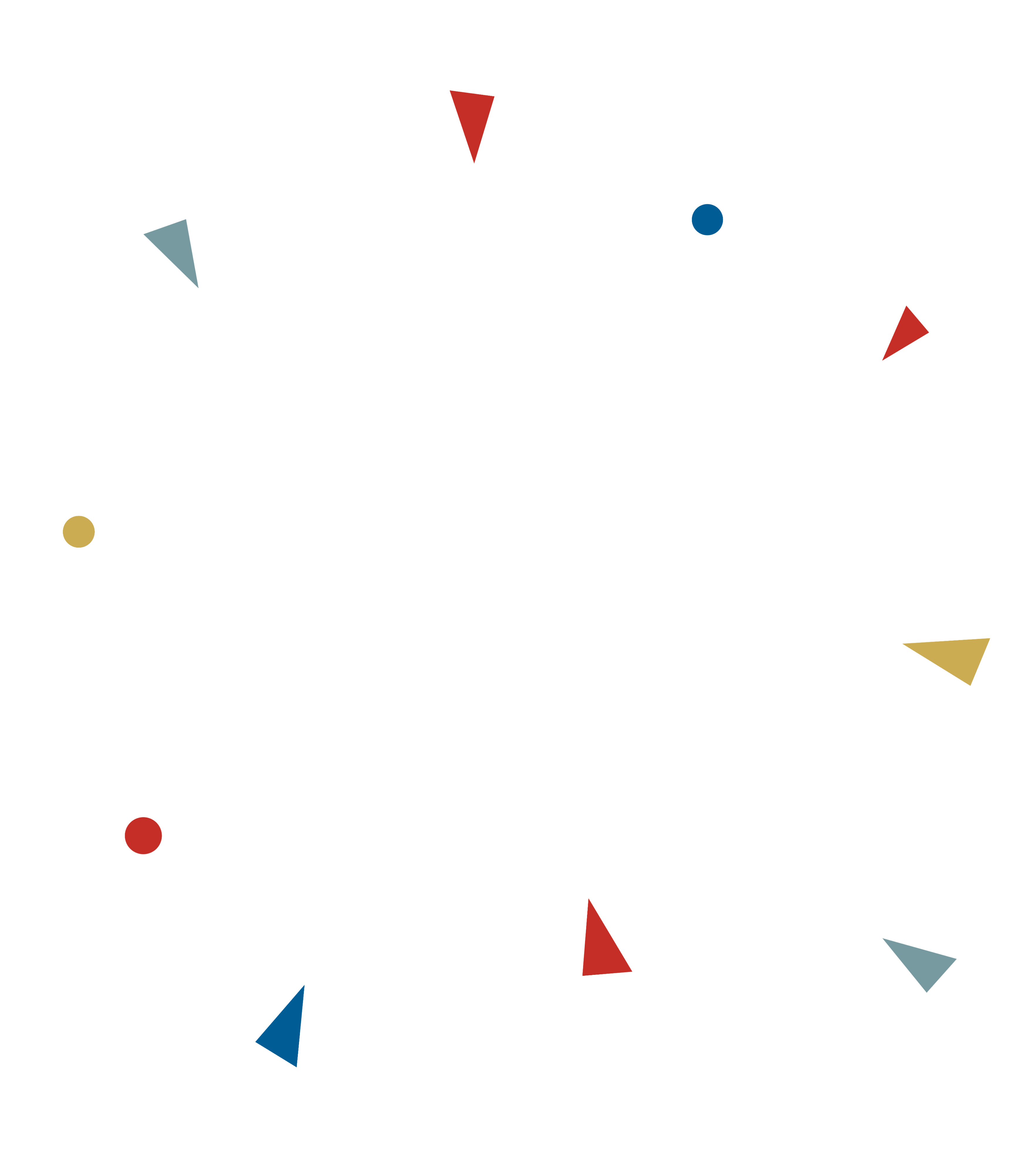
Nicht nur Religion, auch eine gemeinsame Kultur kann eine jüdische Identität ausmachen.
Nach religiösem Gesetz ist jüdisch, wer eine jüdische Mutter hat (Rapper Drake, Popstar Pink, Physiker Albert Einstein) oder zum Judentum übergetreten ist (Schauspielerin Marilyn Monroe).
Viele religiöse jüdische Männer tragen eine Kippa. Bei jüdischen Hochzeiten zertritt der Bräutigam zum Brauch ein Glas. Makkabi ist ein deutsch-jüdischer Sportverein und Humus und Falafel sind typisch für die israelisch-arabische Küche.
Nicht »typisch« jüdisch: Aber auch Jüdinnen*Juden können Lederhosen tragen und einen Adventskalender haben.
Von weltweit rund 15 Millionen Jüdinnen*Juden leben 7 Millionen in Israel.
Die meisten leben aufgrund einer langen Verfolgungsgeschichte verstreut in aller Welt. In Nordamerika leben davon über 6 Millionen Menschen. Auf Europa verteilen sich rund 1 Million Jüdinnen*Juden.
Rund 94.000 Menschen sind Mitglied einer jüdischen Gemeinde – ob
orthodox, konservativ oder liberal.
Aber nicht alle Jüdinnen*Juden sind religiös.
Geschätzt wird, dass insgesamt
225.000 Jüdinnen*Juden in Deutschland leben.
Die drei großen Weltreligionen haben viele Gemeinsamkeiten: Der Glaube an nur einen Gott, Gebote zum friedlichen Miteinander sowie die Bedeutung Jerusalems als heiliger Ort.
Nicht alle, die sich als jüdisch, christlich oder muslimisch verstehen, sind gläubig und befolgen religiöse Vorschriften.
Antisemitismus ist die Diskriminierung und Verfolgung von Juden*Jüdinnen.
Antisemitismus hat eine jahrhundertelange Geschichte, die im Holocaust mündete.
Noch immer gibt es antisemitische Verschwörungstheorien, die Juden*Jüdinnen für Probleme in der Welt verantwortlich machen.
Im Jahr 2020 wurden rund 1.900 Fälle dokumentiert – gewaltsame Übergriffe und Bedrohungen, Sachbeschädigungen und Hetze.
Das sind etwa 5 Vorfälle pro Tag.
Die meisten Vorfälle werden gar nicht gemeldet.
Die Dunkelziffer ist sehr hoch.
Mehr als ein Drittel der für 2020 erfassten Vorfälle fand online statt. Betroffen sind oft jüdische und israelische Einrichtungen.
Noch mehr antisemitische Vorfälle gab es im öffentlichen Raum, nämlich rund 40 Prozent. Dazu zählen beispielsweise Schmierereien, Angriffe und Bedrohungen auf der Straße, im Bus oder der Bahn und in öffentlichen Gebäuden.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, zu reagieren. Wichtig ist, dass du den Vorfall nicht ignorierst, Hilfe suchst und Betroffene unterstützt.
Eine jüdische Schülerin, die diese Situation erlebt hat, sagt:
»Mir hätte geholfen, wenn die Situation ernst genommen worden wäre. Viele waren schockiert, aber sahen es als Einzelfall. Ich hätte mich besser gefühlt, wenn sie es als Symptom einer langanhaltenden Krankheit in Deutschland verstanden hätten.«